
Gespräch mit dem Staatsrechtler Christian Behrendt. Geboren wurde er 1974 in Bonn, aber seit fast drei Jahrzehnten lebt er in Belgien. Behrendt wurde 2008 Lehrstuhlinhaber an der Universität Lüttich (ULg), lehrt aber auch an der Katholischen Universität Löwen (KUL). Der Jurist hat sich auch als Berater des über die Einhaltung des Rechts wachenden Belgischen Staatsrats einen Namen gemacht und ist seit 2023 deutscher Honorarkonsul in Lüttich.
In sechs Jahren sollen 200 Jahre Belgien feierlich begangen werden. Welches sind die Haupterrungenschaften des Landes?
Wenn sie den Bogen sehr weit spannen, dann ist es gelungen, den Wohlstand der Menschen durch zwei Weltkriege hindurch zu sichern. Belgien hat sich zudem auch von einer für das Land sehr abträglichen Neutralitätspolitik hin zu einem überzeugten europäischen und atlantischen Bundesstaat entwickelt.
Und wenn Sie den Bogen enger spannen?
Das Land hat Gefahren gemeistert, die in anderen Ländern durchaus bestehen. Es gibt keine außerparlamentarische Opposition. Selbst Linksextreme stellen sich nach den Regeln des Parlamentarismus zur Wahl. Man muss keinerlei Formen der politischen Gewalt fürchten. Als zum Beispiel in Katalonien die spanische Zentralregierung mit der Nationalgarde gegen das Referendum zur Unabhängigkeit vorgegangen ist, gab es hier in vielen Parteien, nicht nur den flämischen Nationalisten die Haltung: Ja, Freunde, solange das Referendum nicht von Gewalt begleitet ist, sollen die doch abstimmen können.
Also gibt es in Belgien eine tolerante Grundhaltung.
Ich will darauf einfach mal hinweisen, da oft beklagt wird, dass es Belgien schlecht gehe und es eine Zeit der Götterdämmerung gebe.
Durch einen Interessenausgleich zwischen beiden großen Sprachgruppen ist es gelungen, das Land vom Zentral- zum Bundesstaat umzubauen. ist dieser Prozess abgeschlossen?
Der Druck ist natürlich weiter da. Aber wir leben in einem Land, in dem es keine Inlandsflüge gibt. Es ist sehr klein. Das wird manchmal vergessen, auch von entschiedenen Vertretern regionaler Thesen. Selbst die extrem durch Autonomie geprägte Schweiz hat irgendwann erkennen müssen, dass man bei manchen Themen zusammenarbeiten muss, da die Gebietsstrukturen zu klein sind.
Welche Befugnisse könnten in Belgien noch auf die Regionen übergehen?
Die Dinge werden doch komplexer und komplexer. Warum? Die einfachen Dinge sind schon erledigt. 1970 hat man zum Beispiel mit der Übertragung der Zuständigkeit für Museen und Bibliotheken begonnen. Wenn man heute etwa darüber spricht, die Befugnisse für das Gesundheitswesen zu übertragen, dann ist es viel komplizierter. Ein Unfall ereignet sich ja nicht zwangsläufig in der Region, in der jemand wohnt.
In der Covid-Pandemie hat sich gezeigt, dass neun Minister auf föderaler und regionaler Ebene für Gesundheitspolitik zuständig sind.
Das haben gewisse Medien behauptet. Er gibt vier Minister. Das liegt daran, dass es auf föderaler Ebene einen Minister für Gesundheitsschutz und auf regionaler Ebene jeweils einen Minister gibt. Sie sind für die Vorsorge, zum Beispiel die Frage der Impfungen, zuständig. Die Fürsorge ist eine föderale Aufgabe. Das geht auf 1980 zurück. Man kann darüber streiten, ob das die beste Lösung ist. Als Verfassungsrechtler muss ich jedoch sagen: wenn es im Land eine Zweidrittelmehrheit für etwas gab, dann muss ich einen guten Grund haben, das zu kritisieren. Die Unikliniken haben zum Beispiel einen Sonderstatus, für den wiederum andere Minister zuständig sind. Aber wir haben nicht neun Gesundheitsminister, auch wenn das blumiger klingt und sich daraus entsprechende Schlagzeilen machen lassen.
Verfassungsänderungen erfordern im Parlament eine Zweidrittelmehrheit der 150 Sitze. Laut Umfragen könnten der in Flandern führende rechtsradikale Vlaams Belang und die zuletzt auch erfolgreiche linkspopulistische PTB/PVDA gemeinsam auf gut 45 Sitze und so der Sperrminorität von einem Drittel sehr nahe kommen. Gibt es da überhaupt realistische Aussichten auf eine Staatsreform?
Sie brauchen auch eine Mehrheit in jeder Sprachgruppe. Das könnte sogar das größere Problem werden. Wenn die N-VA und der Vlaams Belang die Mehrheit in ihrer Sprachgruppe haben, dann ist das Thema durch – zumindest dann, wenn es auf frankophoner Seite nicht eine ähnlich radikale Position geben sollte. Aus der deutschen Erfahrung heraus wissen wir auch, dass eine Verfassung nur dann sinnvoll ist, wenn sie sich auf eine größere als die übliche Mehrheit stützt und Minderheiten vor Schaden bewahrt.
Ist also eine Zweidrittelmehrheit für eine weitere Staatsreform nicht in Sicht?
Wenn man darüber nüchtern und abgewogen debattiert, dann zeigt sich vielleicht, dass wir dazu nicht in der Lage sind.
Aber es gibt doch, besonders in Flandern, ein großes Unbehagen.
Die Wählerschaft beider Parteien ist vielschichtig. Es gibt nationalistische Romantiker, aber bei der N-VA auch relativ kühle Wirtschaftsleute. Das ist eine relativ große Gruppe, die kein Risiko eingehen will. Sie will exportieren, wenig Staat sowie Ruhe und keinen Ärger mit internationalen Ratingagenturen. Das lässt sich auch daran ersehen, dass viele Wähler von der liberalen Open VLD zur N-VA abgewandert sind.
Wie geht die N-VA damit um?
Sie versucht natürlich, alle einzubinden. Aber man sollte nicht alle Wähler über einen Kamm scheren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die aus fremdenfeindlichen Motiven den Vlaams Belang wählen, aber keine Nationalisten sind.
Demnach gibt es keine Mehrheit für die Spaltung Belgiens.
Genau. Das Paradoxe ist, dass sowohl Vlaams Belang als auch N-VA in ihrem Parteiprogramme die Spaltung des Landes stehen haben. Beide könnten in Flandern zusammen auf eine Mehrheit kommen, doch diese Position könnte, wie in Belgien insgesamt, in der eigenen Wählerschaft nicht mehrheitsfähig sein. Es sind Leute, die befinden sich im rechten oder rechtsextremen Spektrum, sind fremdenfeindlich, fühlen sich übergangen durch die europäische Einigung. Aber sie sind nicht unbedingt für eine flämische Republik.
In Deutschland beruht der Föderalismus auf 16 Bundesländern, in Belgien auf drei Regionen und vor allem den beiden großen Sprachgruppen. Ist da ein bundesstaatliches Modell angemessen?
In den fünfziger Jahren hat man in Belgien über ein föderalistisches Modell mit den damals neun Provinzen nachgedacht, denen die Rolle eines Bundeslandes zugekommen wäre. Auf dem Papier ist das eine sehr gute Idee, sie hatte aber keinen gesellschaftlichen Rückhalt. In einer Demokratie ist es entscheidend, dass die Leute dahinter stehen
Heute gibt es die Vivaldi-Koalition mit sieben Parteien. Es ist sogar die Rede von einer Einbeziehung von Les Engagés, der französischsprachigen Schwesterpartei der flämischen Christlichen Demokraten. Kann man mit acht Parteien vernünftig regieren?
Man braucht eine Mehrheit von mindestens 76 der 150 Sitze. Da wird man sich darüber unterhalten müssen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Die Volksparteien werden immer schwächer, sprechen viele Menschen stets weniger an, in ganz Europa übrigens. Was für Belgien gilt, wird bald vielleicht auch für Deutschland gelten.
Ist in Belgien eine Minderheitsregierung vorstellbar?
Sie brauchen grundsätzlich ein Vertrauensvotum im Parlament. Vorstellbar ist auch, dass eine relative Mehrheit zustande kommt, wenn zum Beispiel 60 Abgeordnete der Regierung das Vertrauen aussprechen und weitere 20 sich enthalten. Aber diese Parlamentarier wollen ja dafür eine Gegenleistung haben. Und sie können die Regierung jederzeit zu Fall bringen. Auf so etwas sich einzulassen, ist sehr riskant und kann nur übergangsweiset gelten.
Mehr oder weniger böse Zungen behaupten sogar, das Land werde dann am besten regiert, wenn das Kabinett nur geschäftsführend im Amt sei.
Zum Haushalt gibt es eine sehr intelligente Regelung. Per Parlamentsbeschuss kann er auf der Grundlage des vorangegangenen Jahres verlängert werden. Das wurde sogar einmal für zwei Jahre so gemacht – ohne Indexierung. Wenn man eine Inflationsrate von drei Prozent hat, wird der Haushalt – real betrachtet – entsprechend konsolidiert. Das schafft fast keine vollständig geschäftsfähige Regierung.
Aber um welchen Preis?
Für Belgiens Rolle in der Eurozone ist das keine schlechte Nachricht. Das Problem dabei ist aber, dass es keinerlei Entscheidung zur neuen Ausrichtung gibt. Man ist regelrecht erstarrt. Das mag noch funktionieren, wenn es nicht plötzlich große außenpolitische und andere Herausforderungen gibt.
Könnten, falls die Regierungsbildung sich wieder lange hinziehen sollte, vorgezogene Neuwahlen einen Ausweg bieten?
Da bin ich grundsätzlich dagegen. Denn wenn Sie nichts vorzuweisen haben, dann wären die Probleme bei einer Wahl nur noch größer, auch weil dies bestimmte Parteien extrem stärken würde. Die könnten dann sagen: Ihr könnt es nicht. Ihr seid alle Versager. Aber eine Parlamentsauflösung mit Neuwahlen ist auch rechtlich kaum vorstellbar.
Premierminister Alexander De Croo genießt, auch international vor dem Hintergrund des laufenden belgischen EU-Ratsvorsitzes, hohes Ansehen. Er gehört in Belgien, nicht zuletzt im französischsprachigen Landesteil, zu den beliebtesten Politikern. Warum stehen seine flämischen Liberalen in den Umfragen so schlecht da?
Das ist ja ein international relativ verbreitetes Phänomen.
Aber das Besondere ist ja, dass es in Belgien zwei große Sprachgruppen gibt und der Regierungschef versuchen muss, es allen sieben Koalitionspartnern recht zu machen.
Ja, er stellt sich nur in Flandern dem Votum der Wähler. Der Südteil erscheint da geradezu als Ausland – und umgekehrt. Andererseits gibt es in Belgien keine verfassungsrechtlichen Hürden, sich landesweit zur Wahl zu stellen. Die Linksextremen tun das, auch die N-VA, die nun auch in der Wallonie antritt. Es muss doch zu denken geben, wenn dies nur Parteien des linksextremen und separatistischen Spektrums, aber keine Parteien aus der Mitte tun.
Wie bewerten sie das politische Klima im Wahlkampf?
Es werden nicht mehr so unmögliche Forderungen gestellt wie zum Beispiel 2010. Das hat damals zu den 541 Tagen geführt, die bis zur Bildung einer neuen Regierung vergangen sind. Jeder hat damals so krakeelt und ist dann gewählt worden, etwa nach dem Motto: ich sorge dafür, dass wir als Flamen überhaupt nichts mehr bezahlen. Oder: Ich sorge dafür als Wallone, dass wir noch viel mehr Geld kriegen. Letztlich hat es eine gewisse Beruhigung der Gemüter gegeben, da man den Wählern nachher erklären musste, warum man Abstriche an den ursprünglichen Positionen vornehmen musste.
Und heute?
Es wird natürlich noch polemisiert. Aber es sagt doch keiner mehr Dinge, von denen er weiß. dass sie unmöglich sind. Man weiß auch, dass man anschließend mit der anderen Sprachgruppe am Tisch sitzen und verhandeln muss. Es ist schon ruhiger geworden, weil man weiß, dass man keine überzogenen Erwartungen wecken sollte.
N-VA-Parteichef Bart De Wever strebt eine Art technokratische Regierung mit der PS, den frankophonen Sozialisten an, um den Boden für eine weitere Staatsreform zu bereiten.
Herr De Wever kann alles Mögliche sagen. Das ist sein gutes Recht. Er ist der Vorsitzende einer großen Partei. Aber das sind nur Stellungnahme, keine absoluten Forderungen. Es gibt im Wahlkampf kaum Positionen, mit denen man etwas vollkommen ausschließt. Der PS-Vorsitzende Paul Magnette hat zum Beispiel gesagt, er setze sich an keinen Tisch, wenn es nicht irgendetwas für die sozial Schwachen gebe. Das wird es wohl schon geben.
Also kommt der Wahlkampf vergleichsweise zahm daher?
Schauen Sie mal auf die Plakate. Die Kandidaten sind darauf alle zu sehen. Aber Slogans gibt es eigentlich wenig. Warum? Weil ein Slogan schon gefährlich sein kann in Anbetracht einer nach den Wahl einzugehenden Koalition mit vielen Parteien.
Was im Wahlkampf, im Unterschied zu Deutschland, auffällt: es gibt relativ viele Bewerber, darunter Ex-Schönheitsköniginnen, Virologen oder Journalisten, die sich nicht in einer Partei hochgedient haben. Wie kommt das?
Mir sind alle Mittel recht, die dafür sorgen, dass es keine außerparlamentarische Opposition gibt und die Entscheidungsfindung in den dafür vorgesehenen demokratisch verfassungsmäßig legitimierten Organen stattfindet. Es muss ja nicht immer ein Parteisoldat sein. Wenn die Parteien Vertrauen in Leute haben und die Bevölkerung der Ansicht ist, dass sie wählbar sind und es sich um Demokraten handelt, dann habe ich kein Problem damit.
Letzte Frage, ein Ratespiel: Wie lange dauert dieses Mal die Regierungsbildung?
Das ist eine Frage, auf die ich nach Ihnen antworten werde.
Die Fragen stellten Reinhard Boest und Michael Stabenow
Siehe auch:
“Bart De Wever befindet sich auf einer Gratwanderung“
Gespräch zu den belgischen Parlamentswahlen am 9. Juni mit Pascal Delwit, Politikwissenschaftler an der Université Libre de Bruxelles (ULB) und dem dort ansässigen Centre d´étude pour la vie politique (CEVIPOL).
“Die Chancen stehen gut für eine Vivaldi-2-Regieurng, aber dann eine mit der N-VA”
Ein Gespräch mit Dave Sinardet. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Brüssel (VUB), wo er Themen wie „Demokratie und Nationalismus“ und „Belgischer Föderalismus“ lehrt. Er ist auch Professor an der UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, wo er auf Niederländisch unterrichtet. Zu Sinardets Forschungsschwerpunkten gehören Staatsreform, Nationalismus und mehrsprachige Demokratie. Er hat bereits zahlreiche wissenschaftliche Beiträge zu diesen Themen veröffentlicht. In seiner Dissertation (Universität Antwerpen, 2007) befasste er sich mit der Rolle der Medien in Bezug auf die „communautairen“ Probleme – das Verhältnis zwischen den Sprachgruppen – der belgischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist Dave Sinardet Kolumnist. Seit 2007 veröffentlicht er regelmäßig Kolumnen in belgischen Qualitätszeitungen, derzeit in De Morgen. Er ist einer der wenigen Intellektuellen, die in der öffentlichen Debatte auf beiden Seiten der belgischen Sprachgrenze aktiv sind, mit Vorträgen, Debatten und Medienauftritten. Sinardet wird auch häufig von internationalen Medien als Experte befragt.



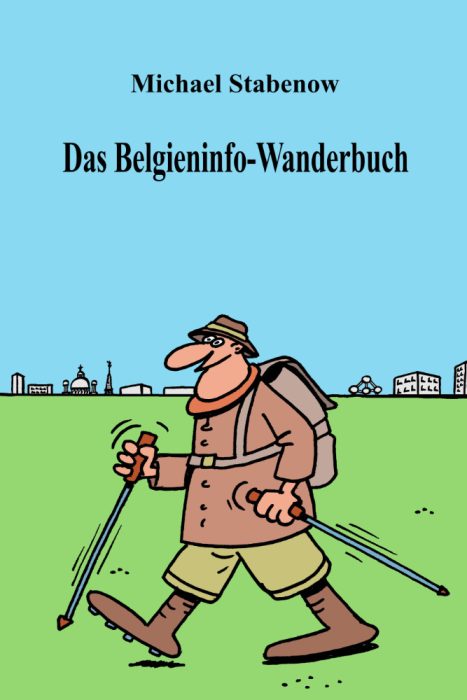
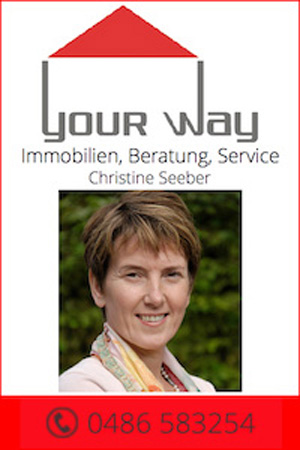
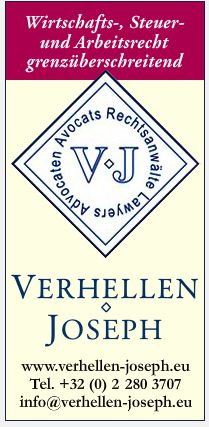
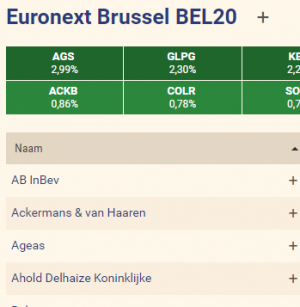
Beiträge und Meinungen