 Von Freddy Derwahl.
Von Freddy Derwahl.
Wer der ostbelgischen Tageszeitung „Grenz-Echo“ zum 90jährigen Jubiläum eine Hommage widmet, sollte gleich mit dem Klischee der „alten Dame“ aufräumen. Damenhaft war das Blatt noch nie, alt sah es manchmal schon früher aus. Für Galanterien und Altersweisheiten hat es in all den Jahren nicht gereicht, dazu blieb auch keine Zeit.
Die Zeitung erschien zum erstenmal am 4. Juni 1927. Seit ihrer Gründung durch interessierte politische Katholiken aus dem Verviers musste sie den steinigen Weg ihres Verbreitungsgebietes durchmarschieren. Über die Druckerschwärze legte sich die Aura einer zwischen alten Grenzsteinen lavierenden Region, in der man Jahrzehnte hindurch nicht frei atmen durfte. Immer waren es anderweitige politische Zwänge, die der observierten Redaktion, neben der Tagesberichterstattung, so oder so, flammende politische Bekenntnisse abverlangten. Das reichte selbst bis zur Todesanzeige, der die unsichtbaren Zensoren einen Hauch Untergrund zutrauten.
 Über allem lag der lange Schatten des Versailler Friedensvertrages. Für die Deutschsprachigen in den Kantonen Eupen, Malmedy und St. Vith war dies zunächst ein verlorener Weltkrieg. Das Kaiserreich, für das man 1914 jubelnd an die Front zog, brach zusammen. Die Toten, Vermissten und Schwerverwundeten wurden schon nicht mehr gezählt. Die siegreichen Diplomaten fackelten nicht lange und schlugen die „Kreise“, wie man sie damals nannte, dem Königreich Belgien zu. Nach offizieller Lesart sollte es eine Art „Heimkehr“ sein, eine Legende, an die selbst die geopolitischen Strategen nicht ganz glaubten, denn die vertraglich zugesicherte Volksabstimmung wurde gefälscht. Die Völkerrechtler drückten beide Augen zu. So ist „Realpolitik“, wenn es sein muss, knallhart.
Über allem lag der lange Schatten des Versailler Friedensvertrages. Für die Deutschsprachigen in den Kantonen Eupen, Malmedy und St. Vith war dies zunächst ein verlorener Weltkrieg. Das Kaiserreich, für das man 1914 jubelnd an die Front zog, brach zusammen. Die Toten, Vermissten und Schwerverwundeten wurden schon nicht mehr gezählt. Die siegreichen Diplomaten fackelten nicht lange und schlugen die „Kreise“, wie man sie damals nannte, dem Königreich Belgien zu. Nach offizieller Lesart sollte es eine Art „Heimkehr“ sein, eine Legende, an die selbst die geopolitischen Strategen nicht ganz glaubten, denn die vertraglich zugesicherte Volksabstimmung wurde gefälscht. Die Völkerrechtler drückten beide Augen zu. So ist „Realpolitik“, wenn es sein muss, knallhart.
Zwischen Vaterland und Muttersprache
Das bald darauf gegründete „Grenz-Echo“ wurde mit patriotischem Hurra verbreitet. Doch die Hoffnung, dass sich das Gros der eingeschüchterten Bevölkerung demütig dem neuen „Vaterland“ zuwenden würde, täuschte. So sehr sich auch der Regierungskommissar General Baltia von Malmedy aus bemühte, diese Politik stiller Übernahme zu orchestrieren, umso mehr bildete sich eine Heim-ins-Reich-Bewegung, die von soliden Mehrheiten unterstützt wurde. Erst mit den antireligiösen Zumutungen der Nazi-Ideologen begann diese Front im streng katholischen Milieu zu bröckeln. Mitten in dem völkischen Streit um das wahre Vaterland kämpfte das „Grenz-Echo“ auf einem schwierigen Posten: Sag mir, wo die Heimat ist…

Erster Chefredakteur war der junge Eupener Journalist Henri Michel, der sich zuvor unter dem Pseudonym „Kickeriki“ in einer sozialistischen Postille an die Öffentlichkeit gewagt hatte. Michel beherrschte die deutsche Sprache wie ein Florett, den Verwaltungsräten passte der kleine Draufgänger ins Konzept. Er kannte offenbar nicht nur die „Internationale“ sondern auch Marienlieder. Michel war ein Troubadour auf dem politischen Hochseil. Etwas Tänzerisches hat ihm immer angehaftet, selbst sein Schritt kam ebenso salopp wie die Artikel.Seine Kommentare gegen die deutschtümelnden Konkurrenz-Blätter waren ein Mix aus nationaler Beschwörung und Attacke.
Um jede Stimme, um jeden Abonnenten wurde gekämpft. Als am 10. Mai 1940 die Wehrmacht in Eupen jubelnd empfangen wurde und der „Völkische Beobachter“ auf Seite eins titelte „Eupen-Malmedy wieder frei“, begann für den noch in der Nacht nach Brüssel geflüchteten Michel eine dramatische Leidenszeit. Bald wurde er von der Gestapo verhaftet und ins KZ Oranienburg-Sachsenhausen verschleppt, wo er als politischer Häftling überlebte und Leidensgenossen aus Kollegenkreisen vorbildlich geholfen hat. Erst nach dem „Hungermarsch in die Freiheit“ kehrte er in die belgische Hauptstadt und sein ernüchtertes Eupen zurück.
Für das „Grenz-Echo“ des Direktors Henri Michel war es die Stunde des Triumphes, mit dem er in der Folgezeit nicht immer fair umging. Die Redakteure aus dem Inland wählten den Widerständler zum Präsidenten des Belgischen Journalistenverbandes, oft sah man ihn neben dem Königspaar auf Staatsempfängen. Niemand wagte es, dem Sieger zu widersprechen. Vielleicht hat er diese Position überschätzt, denn seine Wochenend-Kommentare waren Brandbriefe an die Adresse der alten Gegner. Leserschreiben verfasste er manchmal selbst mit der anonymen Unterschrift „Einer, der dabei war“. Einem kurzlebigen Konkurrenzblatt bot er souverän die Stirn. Er teilte so sehr aus, dass ihn der keineswegs zimperliche Verwaltungsrat mehrmals diskret zur Ordnung rief. Als Michel 1965 unter obskuren Umständen seinen Hut nehmen musste, hinterließ er eine nach wie vor gespaltene Bevölkerung, die zwischen „deutsch“ oder „deutschsprachig“ hin und her gerissen war. Versailles lag bald ein halbes Jahrhundert zurück, doch loderte es in den Ostkantonen noch immer.
Die SPD, ein Emigrant und der Spendenonkel
Dies wurde auch in der Nachfolgefrage deutlich. Weiter herrschte die klammheimliche Angst vor Revanche. Ein sogar den Vervierser Aufsichtsräten genehmer Kandidat, der als Schöngeist den Nazis ins Poesie-Album geschrieben hatte, „Lasst uns pflanzen die Säulen des Reiches in die Verwesung der Welt“, zog es vor, den Posten des Grenz-Echo-Chefredakteurs dem schüchternen Heinrich Toussaint zu überlassen, der jahrzehntelang Michel ergeben gedient hatte.
Aber, Versailles vergessen zu machen, und die 70.000 Deutschsprachigen zu einer politischen Gemeinschaft zu vereinen, konnte Toussaint nicht gelingen. Er war ein gewissenhafter Redakteur, jedoch kein Chef in einer Zeit großen Umbruchs. Im Konkurrenzkampf mit der von seinem ehemaligen Kollegen Willy Timmermann geleiteten Ostbelgien-Ausgabe der „Aachener Volkszeitung“ (AVZ) zog er wiederholt den Kürzeren. Den massiven Aufstieg der ostbelgischen Liberalen im März 1968 ignorierte er. Ein unverdächtiges Zitat des späteren Literatur-Nobelpreisträgers Heinrich Böll durfte wie in einem Polizeistaat nicht ins Blatt. Der erzkonservative Katholik verdächtigte sogar die Konzilsväter der Untreue.

HT schrieb Leitartikel mit Fortsetzungen, weil er sich zwischen der Solidarität mit der Führung seiner „Christlich-Sozialen-Partei“ (CSP) und der aufstrebenden „Partei der Deutschsprachigen Belgier“ (PDB) nicht entscheiden konnte. Er glaubte Recht sprechen zu müssen. Dieser politische Machtkampf, der mit harten Bandagen ausgetragen wurde, hat den guten Mann aufgerieben. Erst als Rentner fand er in der kirchlichen Berichterstattung zu seinem eigentlichen Format zurück, das war nicht wenig.

Toussaints Nachfolger Heinz Warny stammte ebenfalls aus der Grundschule der so genannten „alten Dame“. Während das GE mit den Herausgebern Alfred Küchenberg und Ernst Thommessen in einer „ostbelgischen Lösung“, erstmals ohne wallonische Schwiegermutter, einen umfassenden Reformprozess startete, blieb dem nachdenklichen Chefredakteur nicht viel Zeit. Heftiger Paukenschlag: Ende August 1987 brach die Niermann-Affäre aus: Deutschnationale Millionen-Spender waren bei dem Versuch, in Ostbelgien Wahlkämpfe in ihrem Sinne zu manipulieren, in die landesweiten Medien geraten.
Was im aufgewühlten Ländchen zunächst übersehen wurde, war, dass der bereits schwerkranke „Peuple“-Redakteur und Brüsseler Korrespondent der „Neuen Züricher Zeitung“, der langjährige GE-Mitarbeiter Kurt Grünebaum – ein in der Bonner SPD-Baracke hochgeschätzter jüdischer Emigrant -, mit am Anfang der Enthüllungen wirkte. Das Grenz-Echo bestand diese Herausforderung gegen die tückische Konspiration. Was zeitweise wie ein stellvertretend in ARD, WDR, im „Stern“, „Spiegel“ und „Zeit“ ausgetragener ostbelgischer Bruderkrieg aussah, brachte jenseits aller politischen Täuschungen und den Einmischungen einer korrupten Lütticher Justiz eine historische Wende: Seit den Schlichen des Spendenonkels Hermann Niermann und seines Handlangers Norbert Burger aus dem Kreis südtiroler Bombenleger war den deutschsprachigen Belgiern jede Lust auf Deutschtum vergangen. Der seit Versailles schwelende Konflikt war definitiv beendet. Es war ein historischer Einschnitt: Ostbelgien wollte eine gleichberechtige Autonomie, möglichst als 4. Region in einem föderalen Königreich und im engen Kreis europäischer Partner. Hier stand das Grenz-Echo mit an vorderster Front.
Eine Tageszeitung in der „Blütezeit“

Der agile, wie Henri Michel aus der Linken stammende Gerard Cremer, war als vierter GE-Chefredakteur bereits ein Mann einer neuen gemeinschaftspolitischen Zeitrechnung in Ostbelgien, mit vierköpfiger Regierung, eigenem Parlament, EU-Abgeordneten und Volksvertretern in Kammer und Senat. Die Herausgeber machten aus dem Grenz-Echo ein echtes Verlagshaus mit einem in der Euregio-Maas-Rhein unverzichtbaren Medienstandort, mit Buchproduktionen, Verlagskooperationen, Brüssel-Büro, Internet-Präsenz und Rundfunk-Antenne. Die alten politischen Kämpfe waren geschlagen, die ehemaligen Gegner versöhnt: viel Energie wurde frei für neue Aufgaben.

Vielleicht, weil nach neunzig Jahren im schwierigen Ländchen heute so etwas wie „Blütezeit“ herrscht: Die Deutschsprachigen sind mehrsprachig, das Französische und Niederländisch selbstverständlich, von brauchbaren englischen Sprachkenntnissen ganz zu schweigen. Der mitleidvolle Begriff „Minderheit“ gehört in die Klamottenkiste belgischer Staatsreformen. Die autonome Entwicklung ist vorbildlich. Die ehemaligen Grenzen stehen weit offen. Als guter Nachbar neben der Bundesrepublik, den Niederlanden und Luxemburg liegt Ostbelgien mitten im europäischen Herzland. Schon nahen die Herausforderungen der EU-Krise und der digitalen Revolution, die völlig neue Fragen aufwerfen. Die globale Welt dreht sich wild im Kreis, doch gehört das kleine Ostbelgien dazu. Das, was den echten Belgier und Europäer ausmacht, hat man seit Versailles schmerzlich erfahren müssen. So verlaufen historische Lernprozesse. Man hat sich bewährt und gehört zur Avantgarde. Das „Modell Ostbelgien“ gilt. Im GE steht jetzt zu lesen: „Der König kommt“, oder „Botschafter aus aller Herren Länder reisen zur Besichtigung an.“
Ob es in zehn Jahren, zum 100jährigen Bestehen des Grenz-Echo, noch Grenzen, Echos und eine Tageszeitung gibt, vermag niemand zu sagen. Doch wird es gewiss hierzulande noch viele Menschen geben, die gerne tagtäglich, rund um die Uhr, aktuell, umfassend und vielfältig über ihre Region informiert wären. Daran wird im Zeitungshaus am Eupener Marktplatz gearbeitet.
Freddy Derwahl ist Verfasser mehrerer Bücher und seit vielen Jahren Kolumnist des Grenz-Echo.
Kommentar des Ministerpräsidenten zum 90-jährigen Bestehen des Grenz-Echos
Di e Geschichte des Grenz-Echo war, wie die Geschichte Ostbelgiens, über viele Jahrzehnte geprägt von einer Suche nach der eigenen Identität. Während die deutschsprachigen Belgier zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts ihren Platz im belgischen Staatsgefüge gefunden haben, den es im Falle weiterer institutioneller Reformen zu sichern gilt, ist das Grenz-Echo heute die einzige deutschsprachige Tageszeitung in unserem Land, die den Ostbelgiern eine gedruckte und neuerdings auch gesprochene Stimme verleiht. Eine Tageszeitung, die sich – ähnlich der Deutschsprachigen Gemeinschaft im föderalen Belgien und in einer globalisierten Welt – täglich aufs Neue positionieren und den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft stellen muss. Unsere Demokratie braucht – auch in Ostbelgien – eine freie Presse und eine offene Kommunikation. Dies ist leider keine Selbstverständlichkeit. Nach Angaben einer Studie der unabhängigen US-Stiftung Freedom House ist die globale Pressefreiheit in diesem Jahr auf ein 13-Jahrestief gesunken. Demnach kommen nur 13 Prozent der Weltbevölkerung in den Genuss einer gänzlich unabhängigen Berichterstattung. Ich wünsche dem Grenz-Echo, dass es auf Grund seiner Bedeutung für die Meinungsvielfalt im deutschen Sprachgebiet den Herausforderungen, mit denen Zeitungshäuser aktuell konfrontiert werden, mit Erfolg begegnen kann und wird. Dem Grenz-Echo, seinen Herausgebern und Mitarbeitern die besten Wünsche zum Jubiläum!
e Geschichte des Grenz-Echo war, wie die Geschichte Ostbelgiens, über viele Jahrzehnte geprägt von einer Suche nach der eigenen Identität. Während die deutschsprachigen Belgier zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts ihren Platz im belgischen Staatsgefüge gefunden haben, den es im Falle weiterer institutioneller Reformen zu sichern gilt, ist das Grenz-Echo heute die einzige deutschsprachige Tageszeitung in unserem Land, die den Ostbelgiern eine gedruckte und neuerdings auch gesprochene Stimme verleiht. Eine Tageszeitung, die sich – ähnlich der Deutschsprachigen Gemeinschaft im föderalen Belgien und in einer globalisierten Welt – täglich aufs Neue positionieren und den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft stellen muss. Unsere Demokratie braucht – auch in Ostbelgien – eine freie Presse und eine offene Kommunikation. Dies ist leider keine Selbstverständlichkeit. Nach Angaben einer Studie der unabhängigen US-Stiftung Freedom House ist die globale Pressefreiheit in diesem Jahr auf ein 13-Jahrestief gesunken. Demnach kommen nur 13 Prozent der Weltbevölkerung in den Genuss einer gänzlich unabhängigen Berichterstattung. Ich wünsche dem Grenz-Echo, dass es auf Grund seiner Bedeutung für die Meinungsvielfalt im deutschen Sprachgebiet den Herausforderungen, mit denen Zeitungshäuser aktuell konfrontiert werden, mit Erfolg begegnen kann und wird. Dem Grenz-Echo, seinen Herausgebern und Mitarbeitern die besten Wünsche zum Jubiläum!




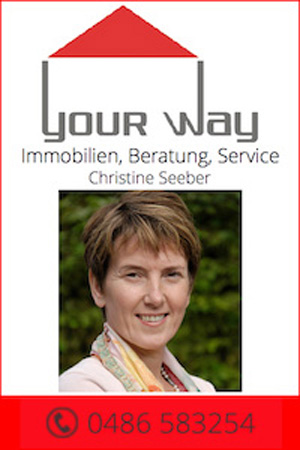

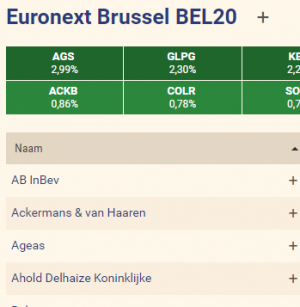
Beiträge und Meinungen