
Von Thomas A. Friedrich
Wie geht es weiter mit der Kernkraft in Belgien? Während in Deutschland ein Untersuchungsausschuss aktuell das Abschalten der letzten drei deutschen Atommeiler im Frühjahr 2023 aufarbeitet, meldet die Internationale Energieagentur (IEA) eine weltweite Renaissance der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Auch in Belgien bleibt der Ausstieg aus dem Ausstieg ein Zankapfel. Eine neue Föderalregierung muss Antworten darauf geben, wie es mit den umstrittenen Restlaufzeiten von Doel II und Tihange langfristig weitergehen soll.
In dem am 16. Januar veröffentlichten Sonderbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) „The Path to a New Era for Nuclear Energy“ rangiert Belgien im Jahre 2023 auf der globalen Kernenergie-Skala beim Anteil der Stromerzeugung aus Kernkraft mit einem Anteil von über 40 Prozent auf Platz sechs unter den 31 IEA-Mitgliedstaaten. Am stärksten auf Kernenergie setzt Frankreich mit aktuell nahezu 65 Prozent Stromerzeugung aus Kernkraft. Auf Platz zwei findet sich die Slowakische Republik mit einem Anteil von über 60 Prozent Atomstrom. Drittgrößter Atomstrom-Produzent stellt die Ukraine mit nahezu 50 Prozent dar. Ungarn (45 Prozent) und Finnland (43 Prozent) folgen auf Platz vier und fünf.
Die in Paris ansässige IEA sieht angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrizität die Kernkraft auf dem Pfad einer weltweiten Renaissance.
Das Interesse an der friedlichen Nutzung der Nuklearenergie als Quelle zur Stromerzeugung und im Wärmemarkt sei so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren nicht mehr, heißt es in einer IEA-Presseerklärung. Mehr als 40 Länder projektierten einen Aus- oder Neubau von Atomkraftwerken (AKWs). Nach IEA-Einschätzung werde die Stromerzeugung aus den 420 derzeit weltweit am Netz befindlichen Reaktoren im Jahre 2025 einen neuen Höchststand erreichen.
Als Gründe für den Boom nennt die IEA in der westlichen Welt den mit fortschreitender Digitalisierung immensen Strombedarf riesiger Serveranlagen und Datenzentren, den Hochlauf von Elektromobilität im Transportsektor sowie gestiegene Klimaschutzanforderungen. In den aufstrebenden Nationen der Welt sei ferner ein rasant ansteigender Elektrizitätsbedarf mit fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklung in nahezu allen Ländern der Welt zu erwarten.
IEA-Exekutivdirektor Birol: „Kernenergie im Jahre 2025 auf Rekordniveau“
„Es ist heute klar, dass das starke Comeback der Kernenergie, das die IEA vor einigen Jahren vorausgesagt hat, in vollem Gange ist und die Kernenergie im Jahr 2025 ein Rekordniveau bei der Stromerzeugung erreichen wird“, sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.
Derzeit seien weltweit mehr als 70 Gigawatt an neuen Kernkraftkapazitäten im Bau. Dies markiere den stärksten Aufwuchs innerhalb der letzten drei Jahrzehnte. Mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt tragen sich laut IEA-Angaben mit Plänen, die Rolle der Kernkraft in ihren Energiesystemen auszubauen. Insgesamt beträgt der Anteil der Atomenergie weltweit aber nur 10 Prozent.
Entwicklung von kleinen SMR beflügeln Phantasien der Kernenergiebranche
Dabei stelle die neue Generation der SMR-Reaktoren für viele Politiker eine valide Option dar, den weltweiten Energiebedarf und die Pariser Klimaschutzziele auf einen Nenner zu bringen.
Die Abkürzung SMR steht für “Small Modular Reactor“ und bezeichnet die Neuentwicklung von kleinen modularen Reaktoren mit einer elektrischen Leistung von ein bis zu 300 Megawatt (MWe). Reaktoren mit einer Leistung von ca. 1 bis 10 MWe werden als Mikroreaktoren bezeichnet.
Konventionelle Kernkraftwerke weisen nach Definition der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) eine elektrische Leistung zwischen 700 und 1.300 Megawatt (MWe). Das ukrainische AKW Saporischschja stellt mit sechs 950 Megawatt-Reaktoren das größte Atomkraftwerk in Europa dar.
Überblick SMR-Konzepte
Gegenwärtig existieren nach Angaben der Nuclear Energy Agency (NEA) der OECD weltweit fast 100 Konzepte für Reaktoren, die nach heutiger Lesart als SMR eingeordnet werden. Eine einzige davon wurde bereits realisiert (in China), einige wenige sind im Bau.
Frankreich will mit Nuklear-Technologien zum Weltmarktführer aufsteigen
Allen voran wartet die Kernenergienation Nummer 1 Frankreich mit neu zugeschnittenen dezentralen Nuklear-Technologien auf, um die Kernenergie im Energiemix Europas zu verstetigen. Bereits auf EU-Ebene ist es Frankreich gelungen – gegen den Widerstand Deutschlands – in der Taxonomiefrage Kernenergietechnologien als „grüne“ nachhaltige Technologien einzustufen, um Gelder aus EU-Fonds für Forschung sowie Neu-und Umbauten und am privaten Kapitalmarkt zu generieren.
Nach den umstrittenen Laufzeitverlängerungen der belgischen Atommeiler von Doel II und Tihange hat auch die von Alexander de Croo geführte Regierung unter der belgischen EU-Ratspräsidentschaft gezeigt, dass das Nachbarland Belgien auch in Zukunft weiter auf Kernenergie setzen will.
Atomgipfel in Brüssel bringt 14 Mitgliedstaaten auf Kernkraftkurs
So lud Belgien als EU-Ratsvorsitz gemeinsam mit der Internationalen Atomenergie-Agentur im März 2024 zu einem Atom-Gipfel ein mit dem Ziel, Kernkraft als dauerhaften Bestandteil des Energiemixes in Europa zu konsolidieren. Angeführt wird die Allianz von Frankreich, das rund 65 Prozent seines Stroms aus Kernkraft produziert. Das proklamierte Ziel der Atom-Allianz ist es, die in Europa installierte Leistung von Kernkraftwerken bis 2050 auf 150 Gigawatt steigern zu wollen. Dies würde im Vergleich zum aktuellen Stand eine Steigerung um 50 Prozent innerhalb 15 Jahren bedeuten.
Derzeit betreiben zwölf der 27 EU-Mitgliedsstaaten Kernkraftwerke. Nur in Frankreich und der Slowakischen Republik sind derzeit Atomkraftwerke im Bau. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat angekündigt, sechs neue SMR Reaktoren bauen zu wollen. Zu dieser Allianz mit Optionen zum Zubau zählen auch die Niederlande und Belgien. Eine Reihe osteuropäischer Staaten sehen die Errichtung von Kernkraftwerken als günstige Energiequelle als Alternative zu den umweltverschmutzenden Kohlekraftwerken in der Region. Allen voran will Polen als das bevölkerungsreichste Land in der Region mit dem Einstieg in Kernkraft ein Zeichen pro Atomstrom setzen.
Ebenso planen Bulgarien, Finnland, Rumänien und ebenso Schweden den Bau neuer Atomkraftwerke. Im Gegensatz dazu hatte Deutschland seine letzten drei AKW Mitte April 2023 abgeschaltet. Nicht auszuschließen ist es, dass eine von der CDU geführte neue Bundesregierung in Berlin ab 2025 auch die Weichen für neue Kernenergiekonzepte öffnet. Schon heute ist die Bundesrepublik wegen der Ausstiegsszenarien von Atomkraft und Kohle in Dunkelflauten trotz immensem Aufwuchs der Erneuerbaren Energien darauf angewiesen, Atomstrom aus Frankreich einzukaufen.
Kritik am weltweiten Zubau der Kernenergie kommt von dem den Grünen nahe stehenden Wissenschaftler Mycle Schneider. Er weist als Herausgeber des jährlichen World Nuclear Industry Status Report darauf hin, dass Atomenergie sich im Vergleich zu anderen Stromgewinnungs-Technologien im Markt nicht behaupten könne. “Wenn wir uns anschauen, wo investiert worden ist, dann sind allein im Solarbereich Kraftwerke in der Größenordnung von 440 Gigawatt ans Netz gegangen. Das heißt, dort wird massiv investiert.” Investitionen in die Atomkraft seien hingegen mit einem hohen finanziellen Risiko behaftet. Veranschlagte Projektkosten uferten regelmäßig aus. Ebenso werde die durchschnittliche Bauzeit von zehn bis 15 Jahren meist überschritten, so Schneider.
Als prominentes Negativ-Beispiel nennt er die Doppel-AKW-Anlage Hinkley Point C im Vereinigten Königreich. Zu Baubeginn lagen die projizierten Kosten bei gut 20 Milliarden Euro. Inzwischen werden die Kosten auf rund 50 Milliarden Euro veranschlagt und das Fertigstellungsdatum sei erneut von 2025 auf 2030 revidiert worden. Ausgeuferte Kosten und Bauzeit des kürzlich ans Netz gegangenen EPR-Kraftwerks in Flamanville in der Normandie waren jetzt auch Thema eines kritischen Berichts der französischen Rezchnungshofs.
Löst privates Investment künftig staatliche AKW-Finanzierung ab?
Traditionell wurde die Kernkraftentwicklung in der Vergangenheit vor allem von staatlicher Finanzierung getragen, um die Kontrolle über den Kernbrennstoffkreislauf zu sichern. Für einen schnelleren Ausbau wären aus Sicht der IEA aber vor allem private Investoren nötig. Investitionen in Kernkraft bis 2030 beziffert die IEA weltweit auf rund 117 Milliarden Euro, was eine Verdoppelung der bisherigen Aufwendungen ausmachen würde. Ob private Investoren sich engagieren, dürfte aber wesentlich auch davon abhängen, ob aus ihrer Sicht die Investition rentabel ist und welche Belastungen dabei einbezogen werden (etwa der Rückbau und die Endlagerung der Abfälle).
Unlängst hatte Tech-Milliardär Elon Musk Deutschland aufgefordert, zur Atomkraft zurückzukehren und Nuklearenergie deutlich auszubauen. “Ich denke, dass es richtig ist, den Anteil der Kernenergie in Deutschland deutlich zu erhöhen. Das wäre großartig”, sagte Musk in einem öffentlichen Online-Gespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel auf seiner Plattform X.
Belgische Reaktoren sorgen Bürger in Deutschland und Niederlanden
In Belgien formierte sich 2018, als sicherheitskritische Risse in der Reaktorhülle von Tihange bekannt wurden, eine Bürgerinitiative in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) in Eupen gegen die weitere Nutzung der alten belgischen AKW-Reaktoren. Aus Angst vor einem schwerwiegenden Unfall hatten Atomkraftgegner Anzeige gegen den belgischen Staat und die Betreiber der Kernkraftwerke Tihange und Doel erstattet. Die belgischen “Pannen-Reaktoren” Tihange und Doel stehen seit Jahren immer wieder international in der Kritik. Viele Menschen im Dreiländereck Belgien, Deutschland und den Niederlanden fordern seit Jahren die Abschaltung der betagten Reaktoren. Durch Tausende Risse in den Reaktordruckbehältern steige die Gefahr des Berstens, fürchten die Kernkraftgegner.
AKW Tihange 3 und Doel 4 sollen wegen Ukraine-Krieg zehn Jahre länger laufen
Die belgische Atomaufsicht (FANC) und der Betreiber Electrabel traten den Bedenken mit angestrengten Gutachten entgegen. Die als Risse bezeichneten Wasserstoffflocken hätten “überhaupt keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit der Reaktoren”, so die FANC. Dieser “Freifahrschein” bildete die Grundlage für die Entscheidung der belgischen Föderalregierung im Jahre 2023, die Laufzeiten der AKWs Doel 4 und Tihange 3 um weitere zehn Jahre bis 2035 zu verlängern (siehe https://belgieninfo.net/belgische-regierung-einigt-sich-mit-engie-ueber-den-weiterbetrieb-von-doel-und-tihange/) .
Die belgische Regierung und der Energiekonzern Engie einigten sich auf die Laufzeitverlängerung der zwei Atomkraftwerke um zehn Jahre bis 2035. Wegen der Diskussion über die Verteilung der Lasten zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Die Verlängerung sei entscheidend, um die Energieversorgungssicherheit in den nächsten zehn Jahren zu gewährleisten, argumentierte der belgische Premierminister Alexander De Croo, und sei auch eine Folge des Krieges gegen die Ukraine.



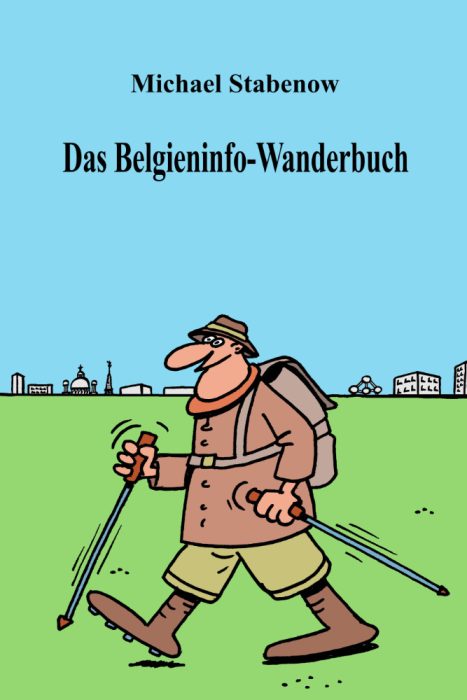
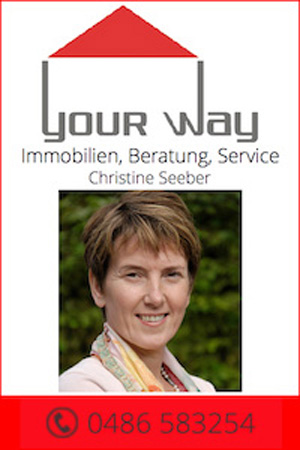
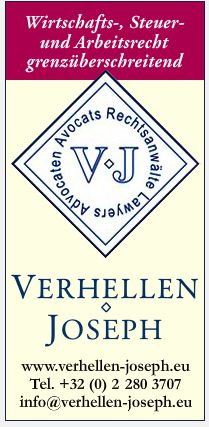
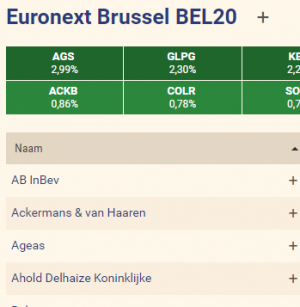
Beiträge und Meinungen