 Von Marion Schmitz-Reiners
Von Marion Schmitz-Reiners
Mitten unter uns lebt eine Gruppe von Flüchtlingen, die vergessen und unsichtbar ist. Es sind Roma aus den westlichen Balkanländern, die nach dem Ende der Jugoslawienkriege nach Belgien kamen und keinerlei Aussicht auf eine Bleiberecht haben. Seit mehr als zehn Jahren schlagen sie sich hier durch, immer in der Hoffnung, dass ihre Kinder einen belgischen Schulabschluss erreichen. Ihre Lebensumstände sind menschenunwürdig, für den Staat existieren sie nicht. Im Aufsehen um die aktuelle Flüchtlingskrise sind sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit untergegangen. In Antwerpen kümmert sich nur eine Handvoll Ehrenamtlicher um sie.
2011 flüchteten sie aus Tirana nach Brüssel: Vater Rahim, Mutter Jelena und die beiden Töchter Myrvete und Katinka, damals zehn und elf Jahre alt. Der Bruder von Rahim war vor dessen Augen auf grausame Weise ermordet, der Täter zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nach seiner schnellen Freilassung durch eine korrupte Justiz hatte der Mörder nur noch ein Ziel: Rahim zu töten, weil dessen Bruder der Grund dafür war, dass er im Gefängnis gesessen hatte.
Rahim ist Roma. Der Täter ist ethnischer Albaner. Roma leben in Albanien in einem rechtsfreien Raum: Vor allem für sie gilt das Gesetz der Blutrache, des „Kanun“. Um der Ermordung des Vaters zuvorzukommen, beschloss die Familie, die Heimat zu verlassen.
Sie verkaufte ihr Hab und Gut. Ein Schlepper brachte sie in seinem Auto nach Brüssel und setzte sie vor dem Ausländeramt auf der Straße ab. Er hatte ihnen den Himmel auf Erden versprochen: schnelle Anerkennung durch den belgischen Staat, ein Haus, Arbeit. Aber tiefer konnte die Familie nicht sinken. Sie schlief monatelang unter freiem Himmel, bis sie in einem Abbruchhaus in Antwerpen unterkriechen konnte. Viermal wurde ihr Asylbegehren abgewiesen.
„Sie wissen genau, wo wir sind“
Katinka und Myrvete, heute 15 und 16, gehen zur Schule und haben gute Noten. Sie sprechen fließend Niederländisch und träumen davon, Krankenschwestern zu werden. Der Vater leidet unter einem schweren „Posttraumatischen Stresssyndrom“. Beim jedem jähen Geräusch hält er sich die Ohren zu und beginnt zu brüllen: Er hört wieder die Schüsse auf seinem Bruder. Die Mutter sorgt rührend für alle, wenn sie nicht gerade beim Niederländischunterricht ist.
Aber was heißt „sorgen“, wenn man in einem eiskalten Zimmer wohnt, in dem der Regen durchs lecke Dach rinnt und der Schimmel die Wände hochkriecht? In dem es zum Kochen eine einzige Elektroplatte gibt, die auf dem Boden steht? Wenn man sein Essen von der Nahrungsmittelbank bezieht, wo es Haltbares wie Reis und Nudeln die Fülle, aber kein Obst und Gemüse gibt? Wie jeden Tag weitermachen ohne einen Cent Einkommen, ohne jede Hoffnung auf ein Bleiberecht in Belgien?

Aber zurück nach Albanien können sie auch nicht mehr. „Sie wissen, wo wir sind“, sagt Katinka. „Sie beobachten uns. Sobald wir in Tirana aus dem Bus stiegen, würden sie sich an die Verfolgung machen. Lieber verhungern wir Belgien, als in Albanien ermordet zu werden.“ Und dann, leise, aber erschreckend nüchtern: „Wir haben auch schon an Selbstmord gedacht.“
Die Schlepper werfen sie in Brüssel aus dem Auto
Ein Familienschicksal von Tausenden. Roma aus dem westlichen Balkan – aus Albanien, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien – sind, vor allem in Belgien, eine Flüchtlingsgruppe, die weitgehend aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist. Im Gegensatz zu osteuropäischen Roma, von denen viele Tausende im Genter Raum wohnen und für die sich mehrere Hilfsorganisationen einsetzen, sind sie keine EU-Bürger. Das macht ihnen das Leben zur Hölle.
1999 und 2000, in den letzten Kriegsjahren, erhielten Roma aus dem Balkan genauso schnell ein Bleiberecht wie heute beispielsweise Syrier. Danach war das Tor zu. Aber viele Familien hofften weiter auf eine Zukunft in Belgien, vor allem, weil die Schlepper ihnen vorgaukelten, sie seien immer noch willkommen. Die Schlepper nahmen ihnen ihr Geld und ihre Pässe ab, warfen sie in Brüssel aus dem Auto und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren.
 Viele Männer setzten sich von ihren Familien ab, als sie erkannten, wie schwer das Leben in Belgien für sie war. Sie verschwanden in düsteren Netzwerken oder kehrten – nicht selten nach einem Gefängnisaufenthalt – zurück in ihre heimatliche Männergesellschaft. Die Frauen und die Kinder blieben. Weil es hier Nahrungsmittelbänke und Kleiderspenden gibt. Weil eine minimale medizinische Versorgung gewährleistet ist. Und vor allem, weil die Kinder hier zur Schule gehen können. Wenn auf dem Balkan Roma-Kinder überhaupt von einer Schule aufgenommen werden, werden sie dort gemobbt und gequält.
Viele Männer setzten sich von ihren Familien ab, als sie erkannten, wie schwer das Leben in Belgien für sie war. Sie verschwanden in düsteren Netzwerken oder kehrten – nicht selten nach einem Gefängnisaufenthalt – zurück in ihre heimatliche Männergesellschaft. Die Frauen und die Kinder blieben. Weil es hier Nahrungsmittelbänke und Kleiderspenden gibt. Weil eine minimale medizinische Versorgung gewährleistet ist. Und vor allem, weil die Kinder hier zur Schule gehen können. Wenn auf dem Balkan Roma-Kinder überhaupt von einer Schule aufgenommen werden, werden sie dort gemobbt und gequält.
700 Euro Miete für einen Verschlag
Die einzige Organisation, die sich in Antwerpen speziell um – vor allem vaterlose – Roma-Familien kümmert, ist „Parochie Sociaal“ (Soziale Pfarrei). Dahinter verbergen sich zwei Innenstadtpfarreien, die Geld für Romafamilien sammeln. Allwöchentlich beraten drei Ehrenamtliche ihre Klienten, beschaffen Windeln und Babynahrung, bezahlen Schulrechnungen, vermitteln Adressen von Ärzten oder Altkleidersammelstellen. Ein schier unüberwindliches Problem aber sind die Mieten für die Verschläge, in denen die meisten Familien hausen müssen, und die hohen Gas- und Stromrechnungen.
Flüchtlingsfamilien, vor allem illegale, sind eine willkommene Beute für Mietwucherer. Schamlos fordern sie bis zu 700 Euro Miete für zwei Zimmer in einer Bruchbude in den Antwerpener Elendsvierteln Seefhoek und Deurne-Noord. Den Frauen bleibt oft nichts anderes übrig, als sich zu prostituieren, um die Miete „bezahlen“ zu können. Die „Vermieter“ – oft sind es Türken – reichen sie dann weiter.
Alle diese Familien leben täglich mit der Angst, von der Polizei aufgegriffen und abgeschoben zu werden. Aber wenn sie – gezwungen oder auch freiwillig – zurückkehrten, wären sie in ihrer Heimat die Parias unter den Parias. Denn Rückkehrer werden dort schon gar nicht geduldet. Hohn und Spott und auch der Ausschluss aus der eigenen Gemeinschaft wären ihnen gewiss.
Letzte Zuflucht: Schweinestall
Pastor Paul Scheelen, der 2011 „Parochie Sociaal“ gründete, weiß davon ein Lied zu singen. Damals holte er erstmals Bettlerinnen, die sonntags vor dem Kirchentor standen, ins Pfarrhaus. „Wir wollten ihnen einen Stuhl anbieten und ihnen zuhören. Das Geringste, was ein Mensch für diese Ausgestoßenen tun kann.“ Einmal ist es ihm gelungen, eine Familie zur Rückkehr zu bewegen – in der Annahme, dass sie in Bosnien wieder aufgenommen würde. „Der Bürgermeister des Heimatdorfs forderte 12 000 Euro von diesen Menschen – angeblich die Steuer für ihr Haus, das einige Jahre leer gestanden hatte. Auch im nächsten Dorf wurden sie abgewiesen. Heute hausen sie in einem Schweinestall zwischen beiden Dörfern.“
Nicht nur wegen solch unerträglichen Aussichten klammern sich die Familien hier fest. Alle Mütter haben die Hoffnung, dass ihre Kinder die Schule in Belgien beenden und die Familie irgendwann ernähren können. Dabei verschließen sie die Augen vor der Tatsache, dass selbst ein Abiturzeugnis in Belgien vollkommen wertlos ist, weil auch die Kinder keinerlei Aussicht auf ein Bleiberecht haben und deshalb nie Arbeit finden werden. Die einzige Möglichkeit, bleiben zu dürfen, ist für eine Roma-Frau, ein Kind von einem Belgier zu bekommen. Denn Kinder dürfen nicht von ihren Vätern getrennt werden.
Und auch dann geraten die Mütter selten oder nie aus ihrer aussichtslosen Lage heraus. Wie Biljana, die zwei Kinder von einem Roma hat, der im Jahr 2000 nach Belgien kam und mithin bleiben darf. Aber Roma-Väter fühlen sich selten für ihre Kinder verantwortlich. Für sie ist es wichtig, ihre Zeugungskraft unter Beweis zu stellen – die daraus entstandenen Kinder sind traditionell die Angelegenheit der Mutter und ihrer Verwandtschaft. Auch Biljana haust mit ihren insgesamt vier Kindern, darunter ein Neugeborenes, in einem unbeheizten Zimmer ohne fließendes Wasser. Immerhin braucht sie nicht mehr die Ausweisung zu fürchten. Die Ehrenamtlichen setzen alles daran, bei den Antwerpener Behörden zumindest zu erreichen, dass wieder Wasser aus dem Hahn kommt.
Nicht existent im bürgerlichen Sinne
Alimente vom Erzeuger ihrer jüngsten Kinder zu fordern, käme Biljana wie Hunderten von anderen alleinstehenden Roma-Müttern nicht in den Sinn. „Dann könnte ich mich nicht mehr auf die Straße wagen. Ich müsste immer befürchten, einen Knüppel über den Kopf zu bekommen. Als Warnung. Der Kindsvater würde es als unerträgliche Beleidigung empfinden, wenn ich ihn zur Kasse bitten würde. Und er hat seine Clique.“
Offiziell sind die meisten Roma aus dem Balkan für den belgischen Staat inexistent. Die Familie von Rahim bekam kürzlich, nach der vierten Ausweisung, das gerichtliche Verbot zugestellt, nach Belgien einzureisen – der Staat setzt also voraus, dass sie wieder in Albanien lebt, wohl wissend, dass das nicht der Fall ist. Sie sind Menschen, die es nicht geben darf.
Wie schrieb kürzlich ein Kolumnist der flämischen Zeitung „De Standaard“? „Das Europa der Aufklärung hat sich die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Das Prinzip der Freiheit ist noch halbwegs intakt.“
Die Autorin Marion Schmitz-Reiners ist Mitarbeiterin von „Parochie Sociaal“. Alle Informationen sowie Spendenkonto: www.deloodsen.be/projecten/parochie-sociaal/






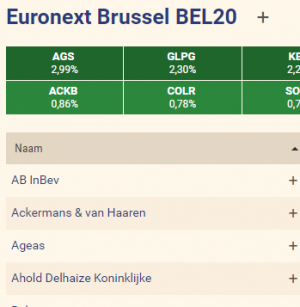
Beiträge und Meinungen