
Von Friedhelm Tromm.
Jeder Expat macht die Erfahrung, wie es ist, plötzlich von einer anderen als der heimatlichen Kultur umgeben zu sein. Für den diesjährigen Träger des Bremer Literatur-Förderpreises ist dieses Erlebnis jedoch tatsächlich die tiefgreifendste Prägung seines Lebens, zumal es für ihn kein Zurück gab. Am 8. März las Senthuran Varatharajah an der internationalen Deutschen Schule.
Die Familie des Autors floh 1984 vor den Wirren des Bürgerkrieges aus Sri Lanka, er selbst ist ein Baby von vier Monaten, als die Familie in Deutschland ankommt. Er wächst in Bayern auf, wo ihn als Kind alle anfassen, wegen seiner Hautfarbe. Deshalb habe er wohl aufgehört, tamilisch zu sprechen, erzählt ihm später seine Mutter. Der begabte Junge macht Abitur und studiert anschließend Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. Er promoviert an der Berliner Humboldt-Universität und bereitet sich auf eine wissenschaftliche Laufbahn vor. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes.
 Die Chance der digitalen Distanz
Die Chance der digitalen Distanz
„Ich hatte ein Begegnung, die mein Leben veränderte“, berichtet der Autor, und fügt sogleich bescheiden lächelnd hinzu: „Das klingt jetzt pathetisch, aber es war so.“ Eines Nachts trifft er in den Weiten des Internets, auf Facebook, eine Frau, die Ähnliches erlebt hat wie er. Sie stammt aus dem Kosovo, aus dem nach dem Zerfall Jugoslawiens viele Albaner vor den Repressalien der Serben fliehen, und landet ebenfalls in Deutschland. „Plötzlich hat alles gepasst“, erzählt Varatharajah, „ich hatte ein Gegenüber, das mich wirklich verstehen konnte, und auch das Medium war das richtige“. Die digitale Distanz war für ihn nämlich eine Chance, sich zu öffnen: „Mit einer wildfremden Person sprechen zu können, obwohl sie – physisch – nicht anwesend ist, war ein großer Trost“, meint er.
Er hat aus diesem Erlebnis einen Roman gemacht, den wohl ersten Facebook-Roman der deutschen Literatur.
 „Vor der Zunahme der Zeichen“
„Vor der Zunahme der Zeichen“
Der Leser wird Zeuge, wie sich die beiden Figuren (Studenten, die sich real offenbar niemals begegnet sind, wie sie bald feststellen) langsam, während des Schreibens, ihrer eigenen Geschichte nähern. Es entsteht kein echter Dialog, sondern eher etwas wie ein wechselseitiger Monolog, bei dem jeder die Gedanken und Assoziationen des anderen aufgreift. Erinnerungen tauchen auf: „die sri lankische armee begann junge tamilische männer festzunehmen und verschwinden zu lassen, sie kamen ohne ankündigung, sie kamen durch wände, sie kamen tag und nacht,meine mutter sah, wie sie in einem jeep an ihrem haus vorbeifuhren. Sie sagt, das sei ein zeichen, sie sagt, bevor diese zeichen zunehmen, sollte er gehen“. Gemeint ist der Vater, der als erster das Land verlässt. „ich glaube, erst jetzt beginne ich zu verstehen, dass von anfang an der tod unserer sprache vorausging. Ich glaube, erst jetzt beginne ich zu verstehen, dass er die bedingung der möglichkeit und wirklichkeit unseres sprechens war, ist und bleiben wird, bis zum ende“, heißt es in dem Roman an anderer Stelle.
Ein neues Leben mit neuen Zeichen
Beide Figuren verlieren eine Kultur, vor allem eine Sprache, und damit etwas Unersetzliches: „Mein Vater sagt, dass nichts in eine andere Sprache übersetzt werden könne, kein Ausdruck besitzt eine Entsprechung, jedes Wort verliert sich und geht verloren“, erzählt die Albanerin Valmira. Und Buchstaben sind für beide mehr als bloße Zeichen. In der tamilischen Grammatik heißen Konsonanten „Körperbuchstaben“ und Vokale „Seelenbuchstaben“, erfährt der Leser.
Das Erlernen der neuen Zeichen bedeutet dabei Verlust und Gewinn zugleich. Im Klassenzimmer hat Senthil die Buchstaben der neuen Sprache vor Augen, das „A“ trägt dabei für ihn die Zeichen des Todes: „das alphabet“ begann „mit der silhouette einer totenbehausung, teils in die erde gegraben, teils über sandigem boden errichtet, die stille einer pyramide“.
Und „Jeder Buchstabe hat seinen Preis“, merkt Valmira, als ihr klar wird, dass „Papiere“, ein für Flüchtlinge manchmal lebensentscheidendes Wort, nicht einfach der Plural von „Papier“ ist. Und sie stolpert buchstäblich über die in der Schule gelernte metaphorische Redewendung „über seinen eigenen Schatten springen“, als sie auf dem Schulhof genau das, natürlich vergeblich, versucht.
Am Ende kein Blick zurück
Varatharajan liest das alles sehr ruhig, fast einförmig vor, im sachlichen Ton eines Chronisten, einem Ton ganz ohne Larmoyanz, ohne Wehmut, ohne Klage.
„Es liegt nicht in meiner Natur, wütend zu sein“, sagt er, abermals lächelnd, aber vielleicht hat er sich auch eine Maxime Adornos zu eigen gemacht, dessen Werk er intensiv studiert hat: „Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend: Denken hat die Wut sublimiert“.
Oder hat er die biblische Geschichte von Lots Frau vor Augen, die im Roman ebenfalls Erwähnung findet? Zurückzublicken kann für diejenigen, die den Katastrophen entronnen sind, auch bedeuten: erstarren, lebensunfähig werden, zugrunde gehen.
Er wollte wohl niemals an etwas festhalten, was unwiederbringlich verloren ist und „Versuche von der tamilischen Community, das Buch zu vereinnahmen, für die Interessen dieser Gruppe“, weist er zurück.
Sein Blick ist nach vorne gerichtet, er hat sich gewissermaßen neu erfunden: „Das Thema ‚Flucht’ ist sicher ein Lebensthema“, bemerkt er, „aber für mich ist es, jedenfalls literarisch, jetzt abgeschlossen.“
 Angeregte Diskussion
Angeregte Diskussion
„Was haben Sie als nächstes vor?“, wollen die zuhörenden Schüler wissen. „Es gibt schon Pläne für zwei weitere Bücher“, teilt der Autor mit: „Im Moment schreibe ich an einem Liebesroman, in dem das Wort ‚Liebe’ nicht ein einziges Mal vorkommt.“ Dass er dies sorgenfrei tun kann, verdankt er diesem und anderen Preisen, die ihm sein Debüt eingebracht hat, „und das ist ein großes Privileg“, fügt er dankbar hinzu.
Am meisten interessiert das Publikum: „War das Gespräch wirklich so wie im Roman?“. Varatharajah ist sich bewusst, dass Jugendliche auf Facebook anders kommunizieren, schneller, kürzer, mit vielen Emojis. „Doch, das Gespräch war tatsächlich etwa so wie im Roman. Aber darüber hinaus hat es mich literarisch gereizt, bestimmte Erwartungen, die an einen Facebook-Chat gestellt werden, eben NICHT zu erfüllen.“
 Dank der Bremer Landesvertretung konnten iDSB-Schüler zum neunten Mal in Folge einen ‚echten’ Bremer Literatur(förder)preisträger und sein Werk live erleben. Und das ist etwas Besonderes, gehört doch der Bremer Literaturpreis zu den „big five“ der deutschen Literaturpreise, wie Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen, hervorhebt.
Dank der Bremer Landesvertretung konnten iDSB-Schüler zum neunten Mal in Folge einen ‚echten’ Bremer Literatur(förder)preisträger und sein Werk live erleben. Und das ist etwas Besonderes, gehört doch der Bremer Literaturpreis zu den „big five“ der deutschen Literaturpreise, wie Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen, hervorhebt.
Vielleicht sind es Events wie diese, die im Gedächtnis der Schüler mehr Spuren hinterlassen als so manche ‚normale’ Unterrichtsstunde und so, ganz im Sinne des vorgestellten Buches, ‚Zeichen setzen’.
Bericht und Fotos: Friedhelm Tromm
Zusätzliche Info:






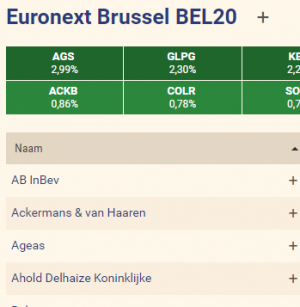
Beiträge und Meinungen