
Von Wulf Conrad.
„Hello, my name is Jamshid and I’m from Afghanistan. Don’t worry, my friend, I speek English quite well…“, sagt der junge Afghane, der den Becher mit heißem Tee dankbar entgegennimmt und mich in den nächsten Tagen immer wieder mit seiner persönlichen Geschichte belohnt. Er ist einer von vielen Flüchtlingen die voller Hoffnung aufgebrochen sind und sich Europa ein neues besseres Leben erhoffen. Am Office des étrangers in Brüssel erzählt er mir von seinem gefährlichen Leben unter den Taliban, seinen Träumen, seinen zerplatzten Träumen, aber auch von seinem ungebändigten Hunger, aus seinem jungen Leben etwas Sinnvolles zu machen.
Nachdem ich bislang eher ein unbeteiligter Zuschauer der erschreckenden Bilder von vor Krieg und Elend flüchtenden Menschen gewesen war, ist die Situation in den letzten Monaten konkreter und greifbarer geworden. Geschichten wie die des jungen Jamshid gibt es viele und viele der Menschen erzählen sie auch, wenn man bereit ist zuzuhören. Geschichten von einem besseren Leben, von Krieg und Flucht, von der mühsamen Einwanderung in ein fremdes Land. Ich habe das Bedürfnis zu helfen, einen kleinen Beitrag zu leisten und sei es nur mit einem kleinen Frühstück für die wartenden Flüchtlinge. Täglich stehen auf der Chaussée d’Anvers unzählige Menschen und warten auf einen so genannten Interviewtermin, um einen Asylantrag zu stellen. Manche warten schon seit Wochen darauf angehört zu werden.
Neues Leben in Brüssel
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selbst vor gut einem Jahr nach Belgien „eingewandert“ bin – sicherlich in keiner Weise vergleichbar mit den Strapazen der Flüchtlinge aus Krisengebieten der Welt. Für mich war der Schritt, für einen gewissen Zeitraum ins Ausland zu ziehen, eine bewusste und gewollte Entscheidung, mit zugegebener Maßen einer existentiell unglaublichen Sicherheit. Ich erinnere mich auch wie ich mich über so manche bürokratische Schwierigkeit geärgert habe, die mir mit dem Blick auf aktuelle Notlagen in Krisengebieten nun fast lächerlich erscheinen. Und dennoch ist es vielleicht auch die Erfahrung, sich selbst wieder in ein neues System integrieren zu müssen, die mich vor Monaten angetrieben haben, mich in Brüssel für in Not geratene Flüchtlinge zu engagieren. Die Menschen, die ich dort seitdem getroffen habe, haben ihre Heimat in der Regel nicht freiwillig verlassen und, wie ich das in Brüssel mitbekomme, auch nur sehr bescheidene Chancen, wieder eine Heimat zu finden.
Wenn man auf einmal in Brüssel lebt, fühlt man sich Europa noch ein bisschen näher. Ich verfolge politische Entwicklungen und Entscheidungen seitdem mit noch größerem Interesse und erhoffe mir Antworten auf die vielen offenen Fragen.
“Wir schaffen das”.
Doch nicht nur hier ist die Diskrepanz groß zwischen einer Politik des Wegschauens und der Ansage der deutschen Bundeskanzlerin – „Wir schaffen das“.
Viele Menschen – auch die, die an eine humanitäre Lösung der Flüchtlingsfrage glauben wollen – sind sich mittlerweile nicht mehr so sicher. Waren wir in unserer Willkommenskultur zu enthusiastisch, zu wenig umsichtig und vorausschauend, zu naiv? Manche haben Grenzzäune hochgezogen oder mit anderen administrativen Finessen versucht, den Einreisestrom zu hemmen und somit mögliche Probleme lieber gleich außen vor zu lassen. Wie kann man sich da als „normaler Bürger“ positionieren?
Verlässt man sich auf die Nachrichten und Talkshows findet man keine klare Antwort auf diese Frage. Das „Flüchtlingsproblem“ scheint noch vielschichtiger zu sein, als man vermutet hatte. Auch die Diskussionsgrundlagen variieren deutlich zwischen einer ökonomischen, rechtlichen, moralischen, humanitären bis hin zu einer persönlich-emotionalen Ebene. Können wir uns die überhaupt leisten? Wer darf denn eigentlich kommen? Wer sollte in Europa welchen Anteil an einer gemeinsamen Lösung haben? Neben beängstigenden xenophoben Rückfällen gibt es in der Zivilgesellscheft glücklicherweise auch ein großes Bedürfnis, zu helfen und sich solidarisch mit den in Not geratenen Menschen zu zeigen.
Flüchtlingshilfe als Erfahrung
Dies scheint mir auch ein guter Weg. Sich selbst ein Bild von der zunehmend verzwickten Lage im direkten Umfeld zu machen und die vielen Fernsehbilder, die uns wichtige Impressionen aus den für uns entlegenen Krisengebieten liefern, durch eigene Eindrücke zu ergänzen. In der direkten Begegnung und im persönlichen Gespräch werden aus der “Flüchtlingswelle” Schutz suchende Individuen, die ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen haben – manchmal (wie bei Jamshid) in gutem Englisch oder Französisch, manchmal mit Händen und Füßen und kleinen Gesten, die dennoch ein Interesse am anderen, gegenseitigen Respekt und Verständigung ermöglichen.
Sucht und findet man den Weg zu Orten der Flüchtlingshilfe, verlässt man die persönliche Komfortzone und spürt auf einmal deutlicher, was es bedeutet, auf der Flucht und damit ohne feste Bleibe und fern der Heimat zu sein. Ich bin ganz ehrlich, am ersten Tag war ich froh, wieder zu Hause zu sein, froh, ein Zuhause zu haben. Ich habe mich in meiner gemütlichen Wohnung umgeschaut, die Heizung ein bisschen aufgedreht und war wieder in meinem Kokon. Seitdem ist einige Zeit vergangen, doch diese Szenewechsel finde ich nach wie vor schwierig. Was mich dann doch regelmäßig an diese Orte zurückgebracht hat, ist die Erfahrung, dass es neben bedrückenden bis erschreckenden Neuigkeiten auch immer wieder gute gibt.
Ich habe selten so viele faszinierende Menschen getroffen und kennengelernt wie in den letzten Monaten. Neben Flüchtlingen sind das vor allem Ehrenamtliche, die versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten und Mut machen, dass es neben düsteren Perspektiven auch viele kleine Zeichen der Hoffnung gibt. Da gibt es Mitmenschen, die Familien aufnehmen oder Unterkünfte vermitteln, die in ihrer kleinen Küche Mahlzeiten für über hundert Leute zubereiten, die Anfängersprachkurse in Französisch oder Niederländisch geben, die Flüchtlinge in administrativen Fragen beraten und bei ihrem schwierigen Gang zum Amt begleiten, die mit Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern stricken, die Konzerte geben oder einfach gemeinsam mit Flüchtlingen singen, die mit Kindern spielen und kleine Ausflüge machen – die Liste ist lang.
 Zeichen der Hoffnung
Zeichen der Hoffnung
Vielleicht ist es genau das, was mir (und anderen Mitbürgern) zurzeit in der Öffentlichkeit fehlt: Zeichen der Hoffnung, die nicht von den Schrecken der Realität ablenken, zu behebende Probleme bagatellisieren oder gar das Gefühl vermitteln, dass es schon irgendwie laufen wird, sondern die uns sehr persönliche und greifbare Perspektiven bieten. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen menschliche Vorbilder und gesunde Inspiration benötigen. Ich würde sogar soweit gehen, zu behaupten, dass Integration neben aller Schwierigkeit auch ein für uns wichtiger und wertvoller Lernprozess sein wird.
Gestern sagte mir eine Freundin, die mit einer kleinen Gruppe einmal die Woche ab 6 Uhr 30 heiße Getränke, Brot und Obst für die neu ankommenden Flüchtlinge vor dem Office des étrangers an der Chaussée d’Anvers bereithält, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, diesen Menschen zu helfen, wenn viele Einzelne ein wenig von ihrem Besitz, ihrer Zeit, ihrer mitfühlenden Gedanken geben würden. Ich habe ihr nicht widersprochen.
Wer helfen möchte – Praktisch ein Nachwort
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der erste Schritt in die Flüchtlingshilfe bei allem guten Willen nicht ganz so einfach ist. Viele potentiell Freiwillige wünschen sich mehr Transparenz und Struktur, wenn es darum geht, konkret dort anzupacken, wo Hilfe wirklich nötig ist. Es gibt Initiativen, die versuchen, System in die Flüchtlingshilfe zu bringen und somit das Potential zu nutzen.
Folgende Webseiten geben einen gewissen Überblick:
https://www.facebook.com/plateformerefugiesbxl
http://www.bxlrefugees.be
Bei Fragen und Interesse, sich selbst zu engagieren, stehe ich auch gerne als Kontaktmann zur Verfügung und vermittle nach meinen Möglichkeiten (kontakt@wulfconrad.eu).




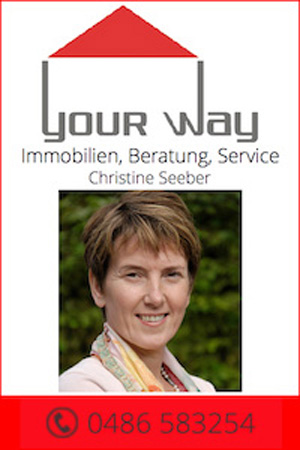

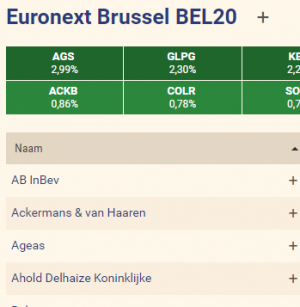
Beiträge und Meinungen