 „Schön, dass hier Lesungen stattfinden, an meiner Schule gab es früher so etwas nicht“, sagte der frisch mit dem Bremer Literaturförderpreis prämierte, überraschend bescheiden auftretende Autor Roman Ehrlich knapp und freundlich, bevor er vor den 9. und 10. Klassen der Internationalen Deutschen Schule aus seinem Werk „Das kalte Jahr“ las, das in diesem Jahr immerhin die Jury eines der bedeutendsten Literaturpreise der Bundesrepublik Deutschland überzeugt hat.
„Schön, dass hier Lesungen stattfinden, an meiner Schule gab es früher so etwas nicht“, sagte der frisch mit dem Bremer Literaturförderpreis prämierte, überraschend bescheiden auftretende Autor Roman Ehrlich knapp und freundlich, bevor er vor den 9. und 10. Klassen der Internationalen Deutschen Schule aus seinem Werk „Das kalte Jahr“ las, das in diesem Jahr immerhin die Jury eines der bedeutendsten Literaturpreise der Bundesrepublik Deutschland überzeugt hat.
Die Erzählung eines Auf- und Ausbruchs
Darin flüchtet der namenlose Erzähler aus der modernen Zivilisation der Stadt und macht sich, durch eine unwirkliche Schneelandschaft, auf den Weg zu seinem Elternhaus am Meer – wo er jedoch nicht seine Eltern antrifft, sondern nur einen merkwürdigen Jungen, der offenbar nun in seinem Kinderzimmer haust.
Manch ein Schüler mag sich in eine Existenzform wie diese hinein träumen, wenigstens zeitweise: ein Leben ohne Schule und ‚Erziehungsberechtigte’, ganz sich selbst überlassen, niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig.
‚Richard’, wie der eigentümliche Junge heißt, bastelt dabei an einem merkwürdigen Gerät mit unklarem Verwendungszweck. Will er vielleicht sogar eine Bombe konstruieren? Drohendes Unheil liegt in der Luft.
Lauter Katastrophengeschichten
Anscheinend passend dazu unterhält der Erzähler den Jungen mit „Geschichten, die nicht in der Zeitung stehen“, über Unglücksfälle, Katastrophen und Schicksale von Sonderlingen: Über einen indonesischen Vulkanausbruch 1815, der zu einer weltweiten Klimaveränderung und einem „Jahr ohne Sommer“ führte. Über die Feuersbrunst, die 1871 Chicago zerstörte. Über das Haymarket-Massaker infolge des berühmten mehrtätigen Streiks in Chicago 1886. Über ein Blutbad an deutschen Soldaten auf Samoa. Über die Mord- und Brandgeschichte von Taliesin, dem Sommersitz von Frank Lloyd Wright.
Ungelöste Rätsel
Der Junge jedoch zeigt keine erkennbare Reaktion, hört er eigentlich richtig zu? Vieles in diesem Roman bleibt rätselhaft, wird nicht aufgelöst. Was ist aus den Eltern des Erzählers geworden? Leben sie überhaupt noch? Und wer ist der Junge? Am Ende vielleicht das Alter Ego des Erzählers, oder so etwas wie sein früheres Ich? Existiert er tatsächlich als Figur der Geschichte, oder nur im Kopf des Erzählers, als Hirngespinst?
Die eher ereignisarme, von Roman Ehrlich sehr ruhig, fast meditativ vorgetragene Erzählung spielt dabei vor einer gleichsam apokalyptischen Kulisse: Wochenlang ist keine Sonne zu sehen, es ist bitterkalt, der Ort, von der Außenwelt abgeschnitten, bleibt sogar ohne jeden Fernsehempfang.
Auch die über das Buch verstreuten Schwarz-Weiß-Abbildungen liefern wenig Erhellendes: Teilweise schemenhafte Graphiken, undeutliche Fotografien, verwischte Winterlandschaften.
Es ist auch ein Spiel mit der schleichend wachsenden Bangigkeit und Verunsicherung des Lesers, der in all dem die Orientierung zu verlieren droht, in Unruhe versetzt und mit seinen aufsteigenden Ängsten wohl bewusst allein gelassen wird.
Viele offenen Fragen
 So braucht das Publikum nach dem Ende der halbstündigen Lesung eine Weile, um aus der Nachdenklichkeit, ja Sprachlosigkeit herauszufinden. Dann aber entwickelt sich ein sehr lebendiges Gespräch zwischen Autor und Schülern, wie immer dynamisch moderiert von Erwin Miethke von der Stadtbibliothek Bremen:
So braucht das Publikum nach dem Ende der halbstündigen Lesung eine Weile, um aus der Nachdenklichkeit, ja Sprachlosigkeit herauszufinden. Dann aber entwickelt sich ein sehr lebendiges Gespräch zwischen Autor und Schülern, wie immer dynamisch moderiert von Erwin Miethke von der Stadtbibliothek Bremen:
„Wie sind Sie eigentlich auf die Idee zu dem Buch gekommen?“
„Ich war in den USA und bin dort auf die Geschichten von deutschen Auswanderern gestoßen, aus einer Zeit, in der die Deutschen dort in einigen Gegenden die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Diese Auswanderergeschichten haben mich fasziniert, ich wollte sie unbedingt in einem Buch unterbringen. Dann habe ich eine erste Fassung des Buches geschrieben, merkte aber, dass ich das Material nicht bändigen konnte, dass ich einen Anfang und einen Schluss brauchte. Ich bin nicht jemand, der, zum Beispiel von einem berühmten „ersten Satz“ aus, einfach los schreiben kann, ich brauche eine Klammer, das habe ich dabei gemerkt. Insgesamt habe ich drei Jahre an dem Buch gearbeitet.“
„Was haben Sie studiert?“
„Ich habe am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig ‚literarisches Schreiben’ studiert. Gut war, dass es dort einen regen Austausch mit anderen Schreibenden gab, dass Kontakte zu Verlegern und Agenten hergestellt wurden. Dennoch frage ich mich im Rückblick, ob ich nicht etwas anderes hätte studieren sollen, Schriftsteller wäre ich wohl sowieso geworden.“
„Welches sind Ihre Lieblingsbücher?“
„Früher habe ich vor allem viele Filme gesehen, mein Vater nahm mich immer in die Videothek mit, wo ich mir etwas aussuchen konnte. Dann habe ich entdeckt, dass es zu vielen Filmen auch Bücher gibt. Schließlich merkte ich, dass Bücher oft interessanter und spannender sind als Filme. Mein erstes Lieblingsbuch war ‚Der Fänger im Roggen’ von J. D. Salinger, bis heute schätze ich diesen Autor sehr.“
„Und welches ist ihr Lieblingsfilm?“
„Einer flog über das Kukucksnest“.
„Wie schreiben Sie eigentlich? Und können Sie davon leben?“ –
„Meist mit dem Computer, nur manchmal notiere ich etwas handschriftlich. Wenn ich einen Preis bekomme, wie jetzt, kann ich auch davon leben, aber man sollte nicht des Geldes wegen schreiben. Es ist kein Beruf im gewöhnlichen Sinne, mit einer Ausbildung, Vorstellungsgesprächen und einer bezahlten Stelle. Es ist eine Berufung, zu der absolute Freiheit als Grundbedingung gehört.“
Unvergessliches Erlebnis
Am Ende ist es vielleicht genau das, was die Lesungen mit den Bremer Förderpreisträgern immer wieder zu einer so unersetzlichen Erfahrung macht: Die Begegnung mit dem Menschen hinter dem Text. Die Bremer Landesvertretung hat erkannt, wie wichtig es ist, schon Heranwachsenden diese Erlebnisse zu verschaffen. Die Erfahrung zeigt, dass dies Früchte trägt.
Friedhelm Tromm (Text und Fotos)






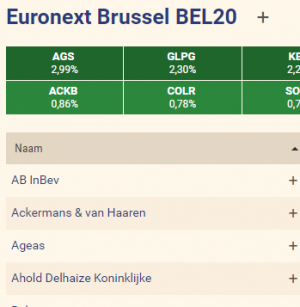
Beiträge und Meinungen